Design Thinking: Neuausrichtung von Innovationen auf Grundlage der Benutzeranforderungen
Der aktuelle Designbereich befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der den Nutzer in den Mittelpunkt stellt und dessen individuelle Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Dieser Wandel erfordert die Überwindung traditioneller Problemlösungskonzepte. Design Thinking bietet diese ganzheitliche Perspektive und ermöglicht Designern, sich intensiv mit dem kreativen Prozess auseinanderzusetzen – durch ausführliche Interviews, um die zugrunde liegenden Nutzerbedürfnisse aufzudecken, durch die Nutzung vielfältiger kreativer Ansätze zur Entwicklung von Projektrahmen und letztlich durch die Sicherstellung, dass Veranstaltungsorte und Produkte genau auf den Lebensstil der Menschen abgestimmt sind.
Lichtdesigner): Die Grundprinzipien des Design Thinking
Design Thinking ist eine innovative Philosophie, die bei der Entwicklung neuer Projekte und Dienstleistungen konsequent die Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse und die Lösung realer Probleme in den Vordergrund stellt. Dieser Ansatz geht über die Optimierung eines einzelnen Produkts hinaus und konzentriert sich auf die Entwicklung ganzheitlicher Lösungen mit dem Ziel optimaler Ergebnisse. Die Kernziele lassen sich in drei Kernpunkten zusammenfassen:

Ein umfassendes Verständnis der Benutzerbedürfnisse, auch der subtilen, selbst derjenigen, derer sich die Benutzer selbst möglicherweise nicht bewusst sind;
Probleme aus mehreren Perspektiven analysieren, proaktiv neue und einzigartige Lösungen erforschen und insbesondere interdisziplinäre Ansätze fördern, die scheinbar nichts mit dem Thema zu tun haben;
Die intensive Zusammenarbeit mit den Nutzern während der Prototyping-Phase stellt sicher, dass die Designrichtung den Erwartungen der Nutzer entspricht. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, Designs zu entwickeln, die die Nutzer wirklich zufriedenstellen, einen langfristigen Mehrwert bieten und ihre Bedürfnisse voll erfüllen. Gleichzeitig muss das Design sowohl die technische als auch die finanzielle Machbarkeit berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Ideen für die Praxis relevant sind.
Die Ursprünge des Design Thinking: Ein innovativer Ansatz aus der Praxis
Woher stammt die innovative Methodik des Design Thinking? Und welche realen Bedürfnisse wurden damit adressiert? In den 1980er und 1990er Jahren wurde Design Thinking im sonnigen Kalifornien geboren, dem Zentrum der dynamischen technologischen Innovation im Silicon Valley und einer Brutstätte für die Vernetzung und Integration kreativer Ideen. Professor David M. Kelley von der Stanford University ist einer der Hauptbegründer dieses Ansatzes, dessen Entstehung eng mit der Zusammenarbeit mit realen Kunden verknüpft ist.
Ein Kunde wandte sich mit einem vorläufigen Konzept an das Studio und wünschte sich zunächst lediglich ein ästhetisch ansprechendes Haus. Später im Projekt schlugen die Designer jedoch eine Reihe bahnbrechender Optimierungslösungen vor, die jedoch aufgrund unzureichender Kommunikation im Vorfeld und anderer Probleme nicht umgesetzt wurden. Diese Erfahrung machte David M. Kelly klar, dass Designer bereits in der Konzeptphase intensiv in Projekte eingebunden sein und in enger Kommunikation mit dem Team und dem Kunden stehen müssen. Dies wurde zu einem entscheidenden Katalysator für die Entwicklung des Design Thinking.
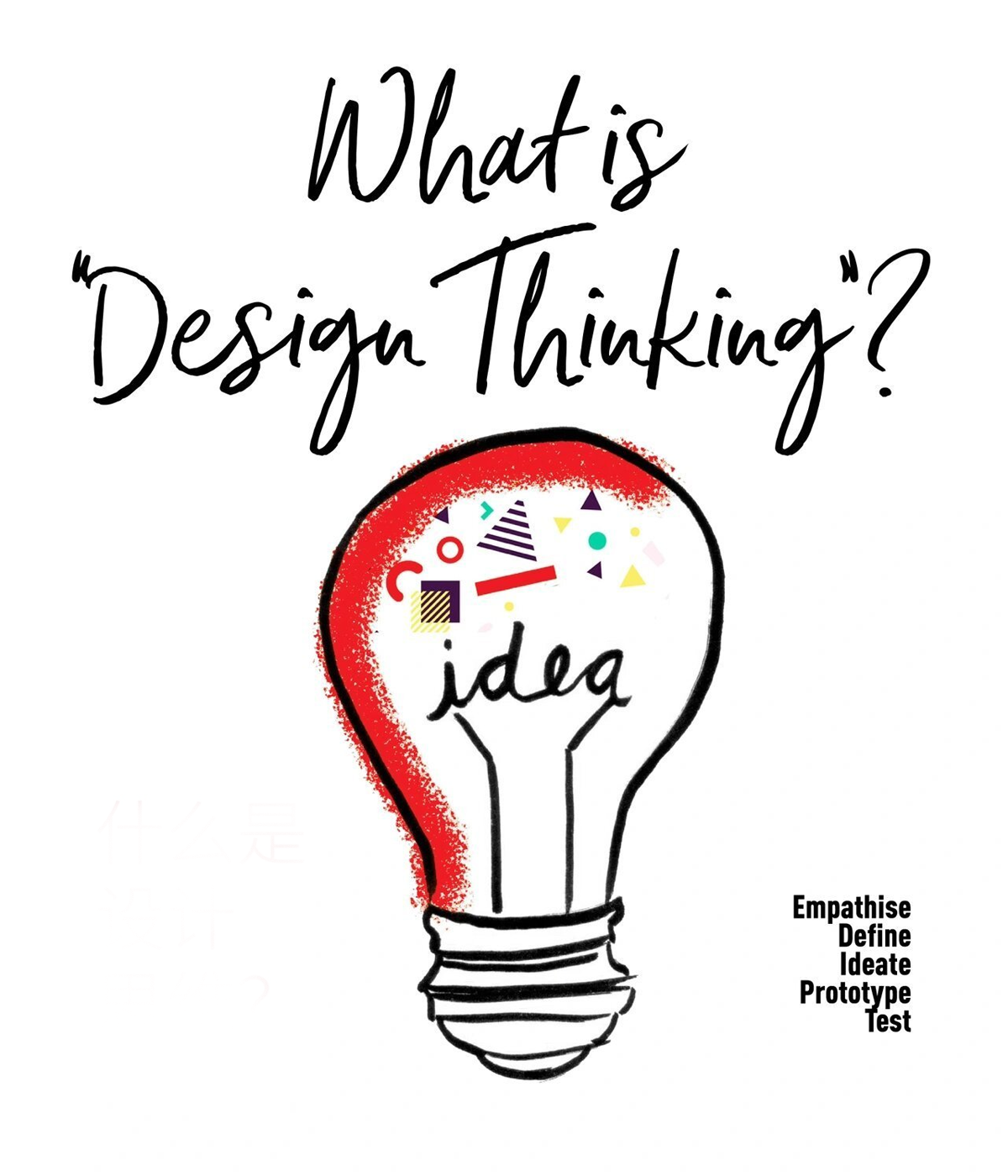
Praxisschritte zum Design Thinking: Der komplette Prozess von der Erkenntnis bis zur Umsetzung
Phase der empathischen Einblicke: Die Kernaufgabe dieser Phase besteht darin, die Verhaltensmotivationen und praktischen Probleme des Nutzers gründlich zu verstehen. Hierzu können Kontextanalysen zur Beobachtung der Umgebung des Nutzers oder ethnografische Interviews zur eingehenden Erforschung seiner wahren Gedanken eingesetzt werden. Sorgfältige und objektive Beobachtungen sind wichtig, da Nutzer sich potenzieller Möglichkeiten zur Optimierung ihrer Arbeitserfahrung in ihren eigenen Gewohnheiten oft nicht bewusst sind.
Problemdefinitionsphase: In dieser Phase werden alle in der ersten Phase gesammelten Informationen systematisch sortiert und verfeinert, um schließlich das zu lösende Kernproblem zu identifizieren. Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe: Eine vorzeitige Definition des Problemumfangs kann den Umfang nachfolgender Forschung einschränken. Ein übermäßiger Zeitaufwand für die Definitionsphase kann die Projektkosten erhöhen und die Effizienz beeinträchtigen.
Kreative Konzeptionsphase: Diese Phase erfordert unkonventionelles Denken, um das Problem anzugehen. Neben fundiertem Fachwissen und Erfahrung ist es entscheidend, die Kreativität voll auszuschöpfen, offen zu bleiben und konstruktive Kritik aktiv anzunehmen. Nach Abschluss dieser Phase muss die optimale Designrichtung als Grundlage für die anschließende Prototypenentwicklung identifiziert werden.
Prototyping-Phase: Die Erstellung eines physischen Modells bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Prototyp entsteht, der dem Endprodukt sehr nahe kommt. Der Schlüssel zu dieser Phase liegt darin, das zugrunde liegende Designkonzept durch den Prototyp klar zu vermitteln, damit Benutzer den Kern der Idee genau verstehen und darauf basierend Vorschläge zur weiteren Optimierung machen können.
Test- und Validierungsphase: Die Validierung von Designideen in realen Benutzerszenarien ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess. Dieser Prozess erfordert die Abstimmung mit Stakeholdern aus verschiedenen Bereichen, darunter Verwaltung, Recht und Technik, und die umfassende Einbindung aller Beteiligten. Erst nach dieser umfassenden Testphase kann festgestellt werden, dass ein Dienst für die endgültige Implementierung bereit ist.
Design Thinking Praxislektionen
Aus der Praxis des Design Thinking haben wir eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Der Kernwert des Design Thinking liegt in der Einführung innovativer und unkonventioneller Lösungen, die die Bedürfnisse der Nutzer präzise erfüllen. Dies gilt insbesondere in Bereichen, in denen es derzeit keine klaren Lösungen gibt und die Vorteile besonders deutlich werden. Design Thinking hat breite Anerkennung gefunden, gerade weil es Wissen aus verschiedenen Disziplinen, darunter Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Ökologie und Technologie, tiefgreifend integriert und so eine umfassende und systematische Methodik bildet.
Anwendung von Design Thinking: Das Beispiel Bürogestaltung
Bürodesign ist eines der besten Beispiele für die operative Logik und praktische Anwendung des Design Thinking. Als gemeinsam genutzte Räume für unterschiedliche Nutzer bieten Büros Platz für Menschen mit unterschiedlichen Arbeitsstilen. Daher muss das Bürodesign nicht nur der visuellen Ästhetik dienen, sondern auch den praktischen Arbeitsanforderungen der Mitarbeiter gerecht werden und sich an ihre täglichen Aktivitäten anpassen. Es muss außerdem das Markenimage und die Grundwerte des Unternehmens verkörpern. Um dies zu erreichen, ist ein interdisziplinärer Ansatz erforderlich, bei dem Interviews auf allen Unternehmensebenen durchgeführt werden, um Input von verschiedenen Interessengruppen zu sammeln. Jedes Feedback und jeder Vorschlag ist wertvoll und trägt letztendlich zum Erfolg des Projekts bei. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass jedes Büro sein eigenes, einzigartiges Betriebsmodell hat und es keine Standarddesignlösung gibt, die für alle Szenarien funktioniert.
In der Bürogestaltung kommt es häufig vor, dass durch verschiedene Ansätze ideale Räume geschaffen werden, die von den Mitarbeitern jedoch nicht effektiv genutzt werden. Das Scheitern solcher Projekte liegt oft nicht an technischen Mängeln oder gestalterischen Problemen, sondern an unternehmenskulturellen Zwängen. In einem hierarchischen, streng geführten Arbeitssystem legen Mitarbeiter beispielsweise Wert auf Privatsphäre und Sicherheit bei der Arbeit. Die erzwungene Schaffung offener Arbeitsbereiche ist in solchen Situationen eindeutig nicht mit den praktischen Anforderungen vereinbar und wird die Akzeptanz der Mitarbeiter kaum finden.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Wert eines gut funktionierenden Büros nicht allein von sorgfältig ausgewählten Büromöbeln abhängt. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter am Arbeitsplatz wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter effektive Beleuchtung, gute Raumluftqualität und eine angenehme Temperatur. Darüber hinaus umfassen die Ansprüche der Mitarbeiter an eine Büroumgebung auch Bereiche wie Grünflächen, Ruhebereiche und Fahrradabstellplätze. Dies zeigt deutlich, dass die Bürogestaltung einen ganzheitlichen, umfassenden Ansatz verfolgen muss, um einen Raum zu schaffen, der den Bedürfnissen der Nutzer wirklich gerecht wird.
Anwendung von Design Thinking im Lichtdesign
Im Bereich Beleuchtung erfordert die Entwicklung hochwertiger Lichtlösungen mehr als nur das Verständnis der Raumstruktur. Wirklich erfolgreiches Lichtdesign erfordert ein tiefes Verständnis der tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer im Raum. Nur durch die enge Integration der Raumeigenschaften mit den Nutzerbedürfnissen können wir eine Beleuchtung schaffen, die sowohl praktisch als auch benutzerfreundlich ist.

